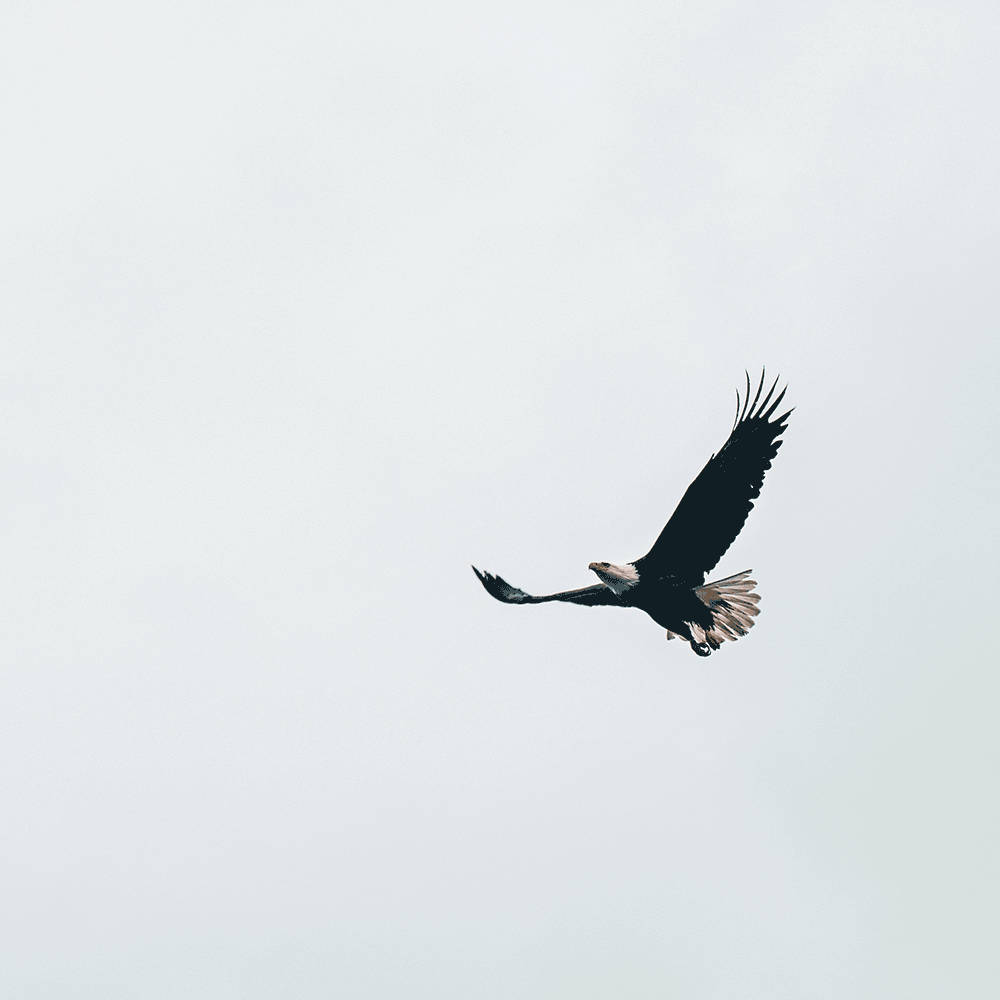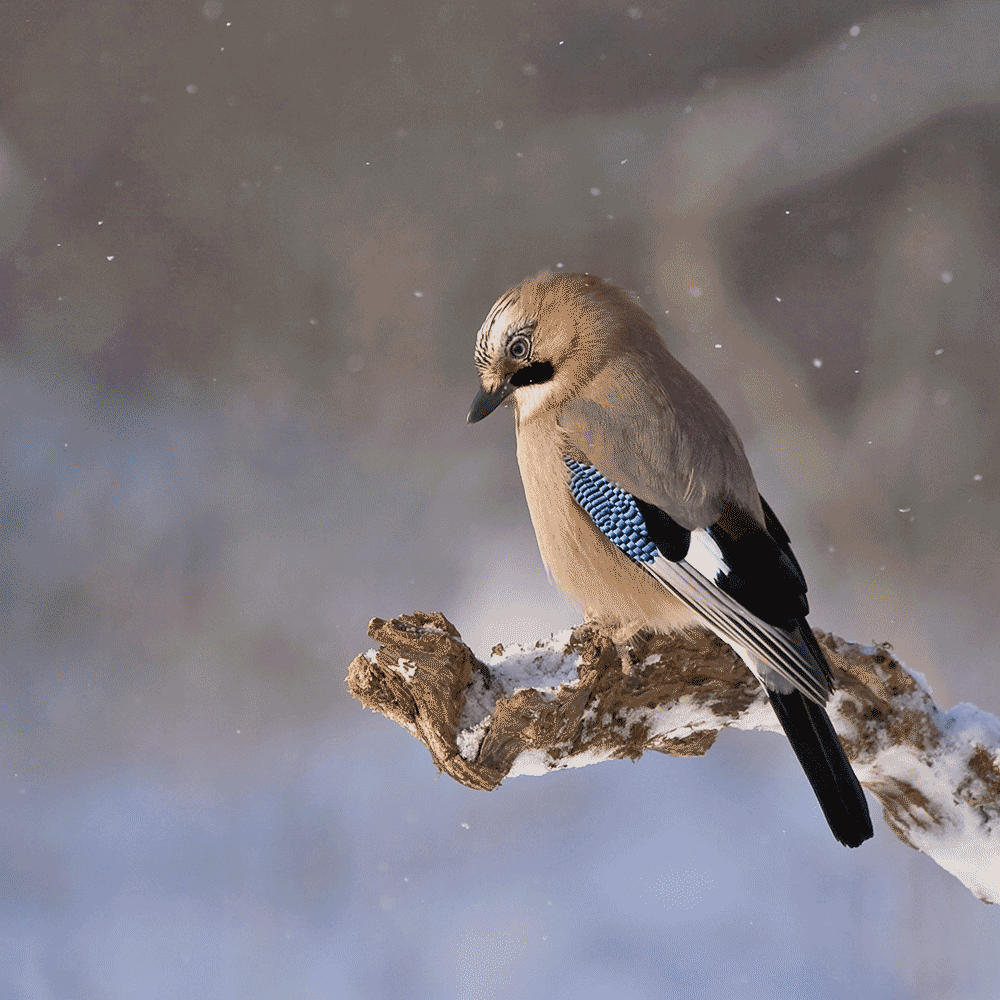Inhalt
- Was bedeutet „betriebsbedingte Kündigung“ eigentlich?
- Wann ist eine betriebsbedingte Kündigung rechtmäßig?
- Ist ein Umsatzrückgang ein ausreichender Grund für eine betriebsbedingte Kündigung?
- Wann ist eine betriebsbedingte Kündigungauf jeden Fall unwirksam?
- Was muss ich tun, wenn ich eine betriebs bedingte Kündigung erhalten habe?
Was bedeutet „betriebsbedingte Kündigung“ eigentlich?
Sie sind von Ihrem Arbeitgeber gekündigt worden und in dem Kündigungsschreiben hat er als Grund für die Kündigung „betriebsbedingt“, „aus betrieblichen Gründen“ oder auch „aus dringenden betrieblichen Erfordernissen“ angegeben? Dann beschäftigt Sie jetzt vermutlich die Frage, ob Ihr Arbeitgeber Sie rechtmäßiger Weise mit einer solchen Begründung kündigen kann und ob es sinnvoll ist, sich gegen eine solche betriebsbedingte Kündigung zu wehren.
Immer dann, wenn Sie Kündigungsschutz genießen, also immer dann, wenn Sie in einem Unternehmen mit mehr als 10 Vollzeit-Mitarbeitern schon länger als 6 Monate beschäftigt sind, dann braucht Ihr Arbeitgeber einen triftigen Grund, wenn er Sie kündigen will. Die Kündigung muss also gerechtfertigt sein und er muss dies im Zweifel vor dem Arbeitsgericht beweisen.
Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) erlaubt dem Arbeitgeber eine Kündigung nur aus drei Gründen:
- aus Personenbedingten Gründen
- aus verhaltensbedingten Gründen oder
- aus betriebsbedingten Gründen
Als „betriebsbedingt“ bezeichnet man eine Kündigung, wenn dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses wegen „dringender betrieblicher Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers entgegenstehen“ (§ 1 KSchG), nicht möglich ist.
Wann ist eine betriebsbedingte Kündigung rechtmäßig?
Damit eine betriebsbedingte Kündigung wirksam ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Betriebliche Erfordernisse:
Es müssen zunächst Umstände vorliegen, die dazu führen, dass Ihr Arbeitsplatz wegfällt. Solche Umstände können beispielsweise der Wegfall von Aufträgen, die Schließung einer Abteilung oder einer Filiale oder die Veränderung von Arbeitsabläufen sein.
2. Dringlichkeit:
Der Wegfall Ihres Arbeitsplatzes allein reicht für die Wirksamkeit der betriebsbedingten Kündigung aber nicht. Es darf darüber hinaus auch keine Möglichkeit geben, Sie auf einem anderen Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen.
3. Sozialauswahl:
Ihr Arbeitgeber muss außerdem soziale Gesichtspunkte bei der Auswahl der Mitarbeiter berücksichtigen, die aus betrieblichen Gründen gekündigt werden sollen.
Bei der betriebsbedingten Kündigung kann sich Ihr Arbeitgeber nicht einfach jemanden „herauspicken“, dessen Nase ihm nicht gefällt, sondern er muss eine Auswahl unter bestimmten sozialen Gesichtspunkten treffen.
Die Ihnen gegenüber ausgesprochene betriebsbedingte Kündigung ist deshalb auch dann unwirksam, wenn Ihr Arbeitgeber die Dauer Ihrer Betriebszugehörigkeit, Ihr Alter, eventuelle Unterhaltspflichten und eine etwaige Schwerbehinderung nicht ausreichend berücksichtigt hat.

Tanja Ruperti, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Berlin
»Ich helfe Ihnen, sich erfolgreich gegen eine rechtswidrige Kündigung zu wehren.«
Ihr Arbeitgeber muss also vor der Kündigung einen Vergleich zwischen sämtlichen mit Ihnen vergleichbaren Mitarbeitern vorgenommen haben, d.h. zwischen solchen, die entweder die gleiche Arbeit machen wie Sie oder die auf einem Arbeitsplatz sitzen, den Sie aufgrund Ihrer Qualifikationen und Ihres Arbeitsvertrags ebenfalls (gegebenenfalls auch erst nach bis zu 6-monatigen Qualifizierungsmaßnahme) einnehmen könnten.
Die Ihnen gegenüber ausgesprochene betriebsbedingte Kündigung ist also nur dann wirksam, wenn Sie gegenüber den anderen mit Ihnen vergleichbaren Kollegen unter Berücksichtigung aller vier Kriterien am wenigsten schutzwürdig sind.
Ist ein Umsatzrückgang ein ausreichender Grund
für eine betriebsbedingte Kündigung?
Nein. Und dies ist vielen Arbeitgebern nicht klar. Eine Vielzahl von Kündigungen wird wegen Umsatzrückgängen oder „notwendiger Einsparungen“ ausgesprochen. Eine schlechte Auftragslage oder der Sparwille allein rechtfertigt eine Kündigung jedoch in keinem Fall.
Im Arbeitsrecht gilt: Das wirtschaftliche Unternehmensrisiko trägt stets der Arbeitgeber. Er kann es nicht in der Weise auf seine Angestellten abwälzen, dass er jedes Mal, wenn der Umsatz zurück geht, Mitarbeiter kündigt und wieder Neue einstellt, sobald die Auftrags- oder Wirtschaftslage sich wieder gebessert hat.
Entscheidend für die Rechtsmäßigkeit der betriebsbedingten Kündigung ist, dass (ein oder mehrere) Arbeitsplätze weggefallen sind. Durch einen Umsatzrückgang selbst fällt aber kein Arbeitsplatz weg. Ein Arbeitsplatz kann nur durch die unternehmerische Entscheidung wegfallen, dass wegen des Umsatzrückgangs Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Jetzt könnte man meinen, der Arbeitgeber hat doch offensichtlich eine solche Entscheidung getroffen, wenn er eine betriebsbedingte Kündigung wegen schlechter Auftragslage ausgesprochen hat. So einfach ist es jedoch nicht. Unternehmerische Entscheidung heißt soviel wie „logisches Konzept“.
Im Fall eines Umsatzrückgangs z.B. wegen Auftragsmangel muss der Arbeitgeber deshalb spätestens im Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht nicht nur konkrete Zahlen vorlegen, die den Umsatzrückgang belegen. Er muss auch belegen, dass er sich wegen des Umsatzrückgangs zu einem Personalabbau in einer bestimmten Größenordnung innerhalb bestimmter Abteilungen oder Aufgabenbereiche entschieden hat und wie er die verbleibenden Arbeitsaufgaben künftig auf die verbliebenen Kollegen verteilen will und warum diese Kollegen die zusätzlichen Aufgaben neben ihren bisherigen miterledigen können, ohne Überstunden zu machen.
Sie sehen: Die Hürden für den Arbeitgeber, eine betriebsbedingte Kündigung zu begründen sind sehr hoch.
Ich habe eine Vielzahl von Mandanten in Kündigungsschutzprozessen nach einer betriebsbedingten Kündigung vertreten und in allen bisherigen Fällen ist es dem Arbeitgeber nicht gelungen, eine solche Kündigung ausreichend zu rechtfertigen, nachdem er mit den richtigen Fragen in die Enge getrieben worden ist. Man einigte sich im Prozess deshalb entweder auf eine angemessene Abfindung oder der Arbeitgeber wurde dazu verurteilt, den Mitarbeiter weiter zu beschäftigen.
Wann ist eine betriebsbedingte Kündigung
auf jeden Fall unwirksam?
Die betriebsbedingte Kündigung ist unabhängig davon, ob die oben genannten Voraussetzungen vorliegen immer dann unwirksam, wenn es in Ihrem Betrieb einen Betriebs- oder Personalrat gibt und dieser vor der Kündigung nicht oder nicht ordnungsgemäß angehört worden ist (letzteres kann im Zweifel nur ein mit dem Betriebsverfassungsrecht vertrauter Fachanwalt für Arbeitsrecht feststellen).
Unwirksam ist die betriebsbedingte Kündigung auch in jedem Fall dann, wenn Sie schwanger oder schwerbehindert sind und Ihr Arbeitgeber vor Ausspruch der Kündigung nicht die Zustimmung der zuständigen Behörde eingeholt hat.
Das gilt auch in den Fällen, in denen der Arbeitgeber bei Ausspruch der Kündigung noch nichts von der Schwangerschaft oder der Schwerbehinderung weiß, soweit Sie diese Mitteilung unverzüglich (spätestens mit Erhebung der Kündigungsschutzklage) nachholen. Mit der rechtzeitig nachgeholten Mitteilung wird die Kündigung sozusagen nachträglich unwirksam.
Was muss ich tun, wenn ich eine
betriebsbedingte Kündigung erhalten habe?
Wenn Sie eine Kündigung erhalten haben, müssen Sie dagegen innerhalb von 3 Wochen beim Arbeitsgericht klagen, sonst gilt die Kündigung als wirksam – egal wie unberechtigt die Kündigung auch sein mag.
Entscheidend für den Erfolg eines Kündigungsschutzprozesses ist oft, dass bestimmte formale Fehler der Kündigung erkannt und unverzüglich gegenüber dem Arbeitgeber eingewendet werden. Der Gesetzgeber setzt Ihnen für solche formalen Einwendungen noch kürzere Fristen als für die Klage selbst. Sie sollten daher nach Erhalt der Kündigung schnellstmöglich – am besten noch am gleichen Tag – einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren.
Ob eine Klage gegen die Kündigung in Ihrem konkreten Fall Aussicht auf Erfolg hat, lässt sich erst nach Prüfung Ihres Arbeitsvertrages, des Kündigungsschreibens sowie Ihrer Darstellung der betrieblichen Situation sagen.
Im Fall einer betriebsbedingten Kündigung erhalten Sie bei mir in aller Regel innerhalb von 24 Stunden einen Beratungstermin. Rufen Sie mich gerne an.
Bitte füllen Sie einfach das Online-Formular aus: