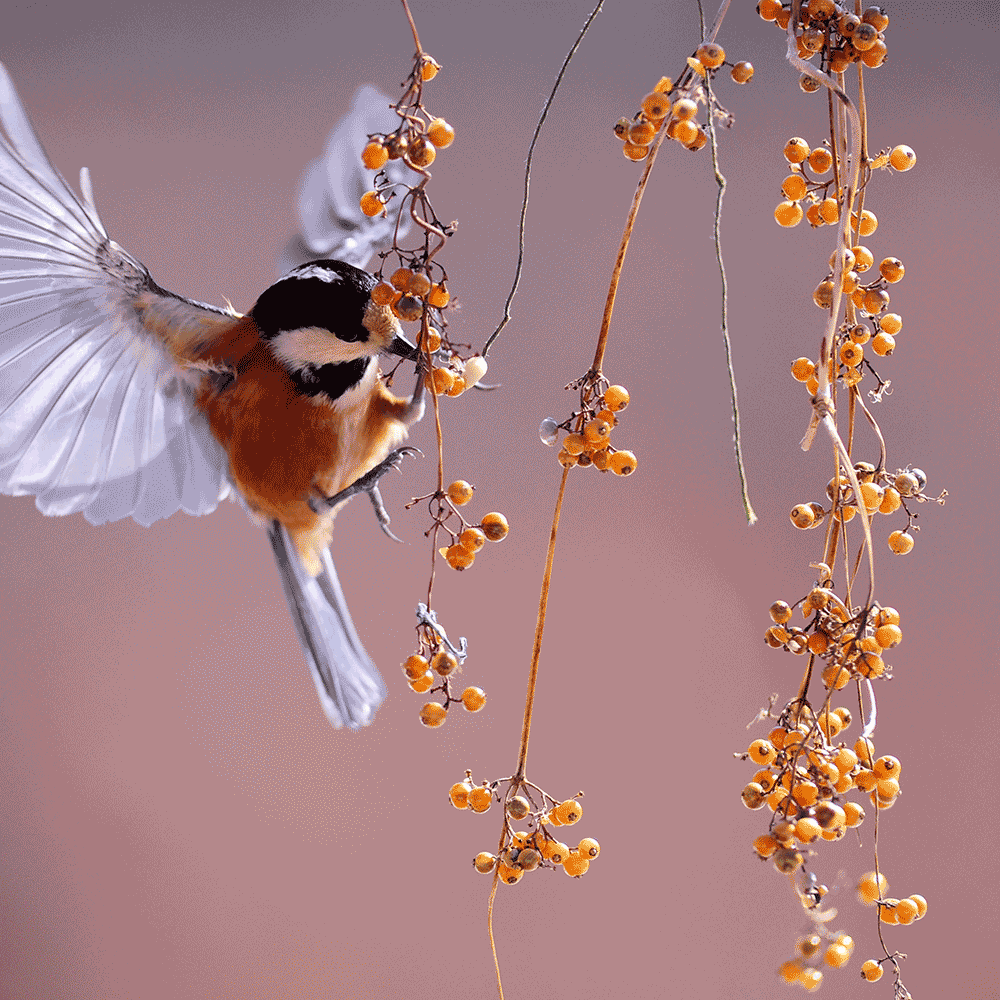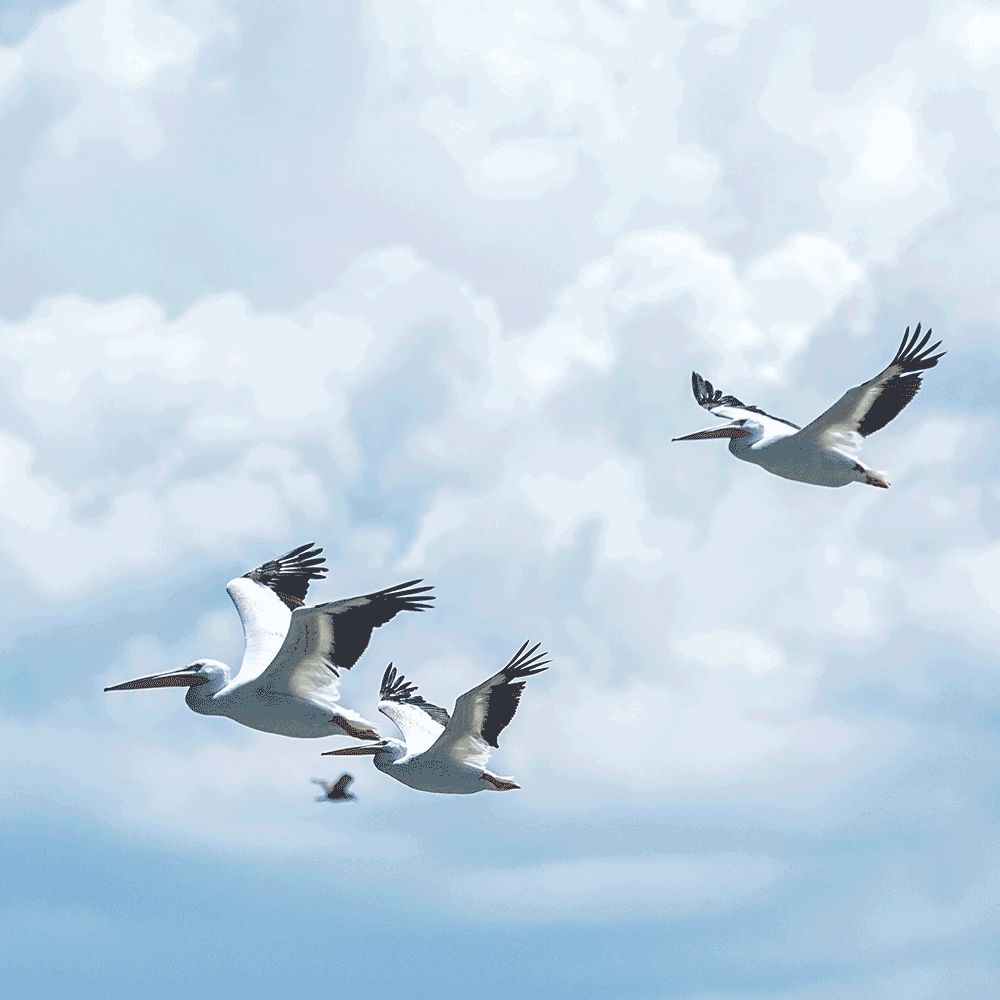Inhalt
- Rückzahlung von Fortbildungskosten Weiterbildungskosten
- Eröffnet die Fortbildung Ihnen neue berufliche Chancen?
- Ist die Fortbildungsvereinbarung klar und verständlich?
- Werden Sie durch den Rückzahlungsgrund auch nicht unangemessen benachteiligt?
- Ist die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung angemessen?
- Verlängern Abwesenheitszeiten die Bindungsdauer?
Rückzahlung von Fortbildungskosten
Weiterbildungskosten
Ihr Arbeitgeber hat Ihnen eine Weiterbildung finanziert, darüber mit Ihnen eine Rückzahlungsvereinbarung geschlossen und verlangt nun die Fortbildungskosten (ganz oder anteilig) zurück? Oder Sie befürchten eine Erstattungspflicht, weil Sie vorzeitig – also vor Ablauf der vereinbarten Bindungsdauer – aus dem Unternehmen ausscheiden wollen?
Die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Rückzahlungsvereinbarungen ist mit zunehmender Bereitschaft von Unternehmen, Ihren Mitarbeitern hochwertige und kostenintensive Weiterbildungen zu finanzieren, eine immer häufiger auftauchende arbeitsrechtliche Fragestellung.
Viele meiner Mandanten kommen bei einem geplanten Ausscheiden aus dem Unternehmen oder einer bereits erfolgten Kündigung mit der Frage zu mir, ob die getroffene Fortbildungsvereinbarung wirksam ist und der Arbeitgeber zu Recht die (anteiligen) Kosten der Weiterbildung zurückfordern kann. Die Sorge meiner Mandanten ist angesichts der oft erheblichen Lehrgangskosten und damit auch des erheblichen finanziellen Risikos für sie, soweit die Rückzahlungsvereinbarung greift, verständlich.
Aus der Vielzahl der mir bislang vorgelegten Fortbildungsvereinbarungen kann ich vorwegnehmend sagen:
Grundsätzlich ist eine Rückzahlungsvereinbarung nur wirksam, wenn die vier nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
- Durch die Fortbildungsmaßnahme eröffnen sich Ihnen neue berufliche Chancen
- Die Rückzahlungsvereinbarung ist nach Grund und Umfang eindeutig
- Der Rückzahlungsgrund benachteiligt Sie nicht unangemessen
- Die vereinbarte Bindungsdauer ist angemessen
Bereits an der ersten Voraussetzung scheitern viele Rückzahlungsvereinbarungen:
Eröffnet die Fortbildung Ihnen neue berufliche Chancen?
Die Wirksamkeit der Rückzahlungsverpflichtung setzt voraus, dass Ihr Arbeitgeber überhaupt ein berechtigtes Interesse an einer zeitlichen Unternehmensbindung wegen der Fortbildungsfinanzierung hat. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Fortbildung, die Ihnen von Ihrem Arbeitgeber finanziert wird, nicht nur für dessen Unternehmen von Nutzen ist, sondern auch Ihnen persönlich einen „geldwerten Vorteil“ bringt, sprich Sie auch nach Ausscheiden aus dem Unternehmen weiterbringt. Etwa deshalb, weil Sie durch die Fortbildung einen höheren Marktwert haben oder sich hierdurch für Sie neue und bessere berufliche Möglichkeiten eröffnen. Ob dies der Fall ist, muss im Zweifel Ihr Arbeitgeber beweisen.

Tanja Ruperti, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Berlin
»Viele Vereinbarungen über die Rückzahlung von Fortbildungskosten sind unwirksam.«
Sie müssen die Kenntnisse, die Sie durch die Fortbildung erworben haben also auch außerhalb des Unternehmens verwenden können. Ist die Fortbildung lediglich innerbetrieblich von Vorteil – wie zum Beispiel bei einer Software-Schulung, die speziell für das Unternehmen entwickelt worden ist und in keinem anderen Unternehmen derselben oder einer anderen Branche verwendet wird – dann dürfen Sie an den Kosten der Fortbildung grundsätzlich nicht beteiligt werden.
Ist die Fortbildungsvereinbarung klar und verständlich?
Wenn die Rückzahlungsvereinbarung Sie unangemessen benachteiligt, dann ist sie unwirksam. Eine solche unangemessene Benachteiligung kann sich neben der vereinbarten Bindungsdauer (siehe unten) auch daraus ergeben, dass die Klausel nicht klar und verständlich formuliert ist.
In der Vereinbarung müssen die Gründe, die Sie zur Rückzahlung verpflichten ebenso eindeutig formuliert sein, wie die Höhe des Rückzahlungsbetrags. Das heißt, nur wenn Sie aus der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung klar erkennen können, in welchen Fällen Sie wieviel Geld an Ihren Arbeitgeber für die Fortbildung zurückzahlen müssen, ist die Regelung klar und verständlich und also nicht bereits wegen Intransparenz unwirksam.
Diese Voraussetzung erfüllen viele Rückzahlungsvereinbarungen nicht.
Aber selbst wenn: Allein dass die Regelung klar und verständlich ist, bedeutet noch nicht, dass sie auch inhaltlich rechtmäßig ist:
Werden Sie durch den Rückzahlungsgrund auch nicht unangemessen benachteiligt?
In der Rückzahlungsvereinbarung muss geregelt sein, unter welchen Bedingungen Sie zur Rückzahlung von Lehrgangskosten verpflichtet sind und diese Gründe müssen von Ihnen beeinflussbar sein. So wird in Rückzahlungsvereinbarungen regelmäßig bestimmt, dass Sie Fortbildungskosten zurückzuzahlen haben, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf eines bestimmten Zeitraums (Bindungsdauer oder Bindungsfrist) beendet wird. Eine Rückzahlungsvereinbarung, die nicht danach unterscheidet, ob der Grund für das vorzeitige Ausscheiden bei Ihnen oder beim Arbeitgeber liegt, ist die Rückzahlungsvereinbarung unwirksam. Sie müssen es selbst in der Hand haben, ob die Rückzahlungspflicht zur Geltung kommt oder nicht.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie immer dann, wenn Ihr Arbeitgeber Sie kündigt nicht zur Rückzahlung der Weiterbildungskosten verpflichtet wären. Wenn Ihr Arbeitgeber Sie aus betriebsbedingten Gründen kündigt, darf er die Fortbildungskosten von Ihnen nicht zurück verlangen.
Wenn der Grund für die Kündigung allerdings bei Ihnen liegt, weil Sie sich vertragsbrüchig verhalten haben, dann liegt die Nichteinhaltung der Bindungsfrist in Ihrer Verantwortung und die Rückzahlungspflicht greift durch.
Umgekehrt sind Sie aber auch nicht immer dann zur Rückzahlung der Weiterbildungskosten verpflichtet, wenn Sie selbst kündigen. Soweit Sie deshalb kündigen, weil Ihr Arbeitgeber sich vertragsbrüchig verhält, weil er beispielsweise Ihr Gehalt über einen längeren Zeitraum nicht zahlt, Sie nicht vertragsgemäß beschäftigt oder gar gemobbt werden oder ähnliches, dann müssen Sie die Fortbildungskosten auch nicht zurückzahlen.
Folgende Gründe für eine Rückzahlungsverpflichtung sind rechtmäßig:
- Schuldhaftes Nichterreichen des Fortbildungsziels
- Abbruch der Fortbildung durch den Arbeitnehmer
- Kündigung des Arbeitnehmers vor Ablauf der angemessenen Bindungsfrist, sofern die Kündigung nicht vom Arbeitgeber selbst verschuldet ist
- Kündigung seitens des Arbeitgebers wegen vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers
Ist die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung angemessen?
Es ist verständlich, dass ein Arbeitgeber ein Interesse daran hat, die Investition in den Mitarbeiter (Bezahlung der Lehrgangskosten und der Überbrückung des Arbeitsausfalls während der Fortbildungsdauer) „wieder rein zu bekommen“ und Sie verpflichten will, für eine bestimmte Mindestdauer im Unternehmen zu bleiben, um von Ihrer Weiterbildung zu profitieren.
In einer Rückzahlungsverpflichtung wird deshalb ein Zeitraum festgelegt, während dessen eine Auflösung des Arbeitsvertrages dazu führen soll, dass die Lehrgangskosten von Ihnen zurückgezahlt werden sollen.
Eine Rückzahlungsvereinbarung ist nur zulässig, wenn die Vorteile der Fortbildungsmaßnahme und die Dauer der Bindung an das Unternehmen in einem angemessenen Verhältnis zu einander stehen.
Das Bundesarbeitsgericht hat hierfür Orientierungswerte entwickelt, die auf der Annahme beruhen, dass die Dauer der Fortbildung ein starkes Indiz für die Qualität der erworbenen Qualifikation ist. Je länger also die Weiterbildungsmaßnahme dauert, desto länger darf auch die Bindungsfrist sein. Eine Bindung über 5 Jahre hinaus ist aber in jedem Fall unzulässig.
Das Bundesarbeitsgericht hält dabei folgende Bindungsdauern bei einer bezahlten Freistellung während der Fortbildungsmaßnahme im Verhältnis zur Dauer der Weiterbildungsmaßnahme für zulässig:
Fortbildungsdauer Bindungsdauer
Bis zu 1 Monat bis 6 Monate
Bis zu 2 Monaten bis 1 Jahr
3-4 Monate bis 2 Jahre
6-12 Monate bis 3 Jahre
2 und mehr Jahre maximal 5 Jahre
Da es sich hierbei um bloße Regelwerte handelt, kann hiervon im Einzelfall unter besonderen Umständen auch abgewichen werden.
Verlängern Abwesenheitszeiten die Bindungsdauer?
Eine häufig gestellte und wichtige Frage ist, ob Abwesenheitszeiten wie Sonderurlaub, Krankheit, Mutterschutz-, Pflegezeit oder Elternzeit die vertraglich vereinbarte Bindungsfrist verlängern, die Ausfallzeiten also hinten angehängt werden können.
Hier gilt: Grundsätzlich nicht wirksam vereinbart werden kann die Verlängerung der Bindungsdauer um solche Abwesenheitszeiten, deren Grund aus der Sphäre Ihres Arbeitgebers stammt. Gleiches gilt für Abwesenheitszeiten, die auf gesetzlichen Schutzfristen beruhen – also für Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit oder auch der Dauer einer Pflegezeit. Auch in diesen Fällen wäre eine vereinbarte Verlängerung der Bindungsfrist unwirksam.
Denkbar ist, dass die Vereinbarung, die Bindungsfrist bei krankheitsbedingten Fehlzeiten zu verlängern, jedenfalls dann wirksam ist, wenn sich gleichzeitig die anteilige Kürzung der Fortbildungskosten bzw. die Verlängerung der Bindungsfrist im Rahmen der Kürzungsregeln des § 4 a Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) hält. Dies ist aber von der Rechtsprechung noch nicht entschieden und müsste im Zweifel gerichtlich geklärt werden.
Nicht ausgeschlossen, aber ebenfalls noch nicht gerichtlich entschieden, ist eine Verlängerung der Bindungsfrist im Fall von einvernehmlich vereinbartem Sonderurlaub.
In jedem Fall bedarf es für eine Verlängerung der Bindungswirkung bei Krankheit oder Sonderurlaub und ähnlichem einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung. Soweit die Verlängerung der Bindungswirkung bei Abwesenheitszeiten nicht geregelt ist, führt eine Abwesenheit nicht zu einer Verlängerung der Bindungsfrist.
Gibt es in Ihrem Vertrag eine solche Regelung, muss geprüft werden, ob die Regelung so wie sie in Ihrem Fall konkret formuliert ist, wirksam ist.
Ob Ihr Arbeitgeber Rückzahlungsansprüche aus der mit Ihnen getroffenen Fortbildungsvereinbarung berechtigter Weise beanspruchen kann, lässt sich erst nach Prüfung der Weiterbildungsvereinbarung beurteilen.
Zurück zur ThemenübersichtAm besten ist, Sie lassen sich anwaltlich beraten. Ich biete Ihnen gerne meine fachliche Unterstützung an.