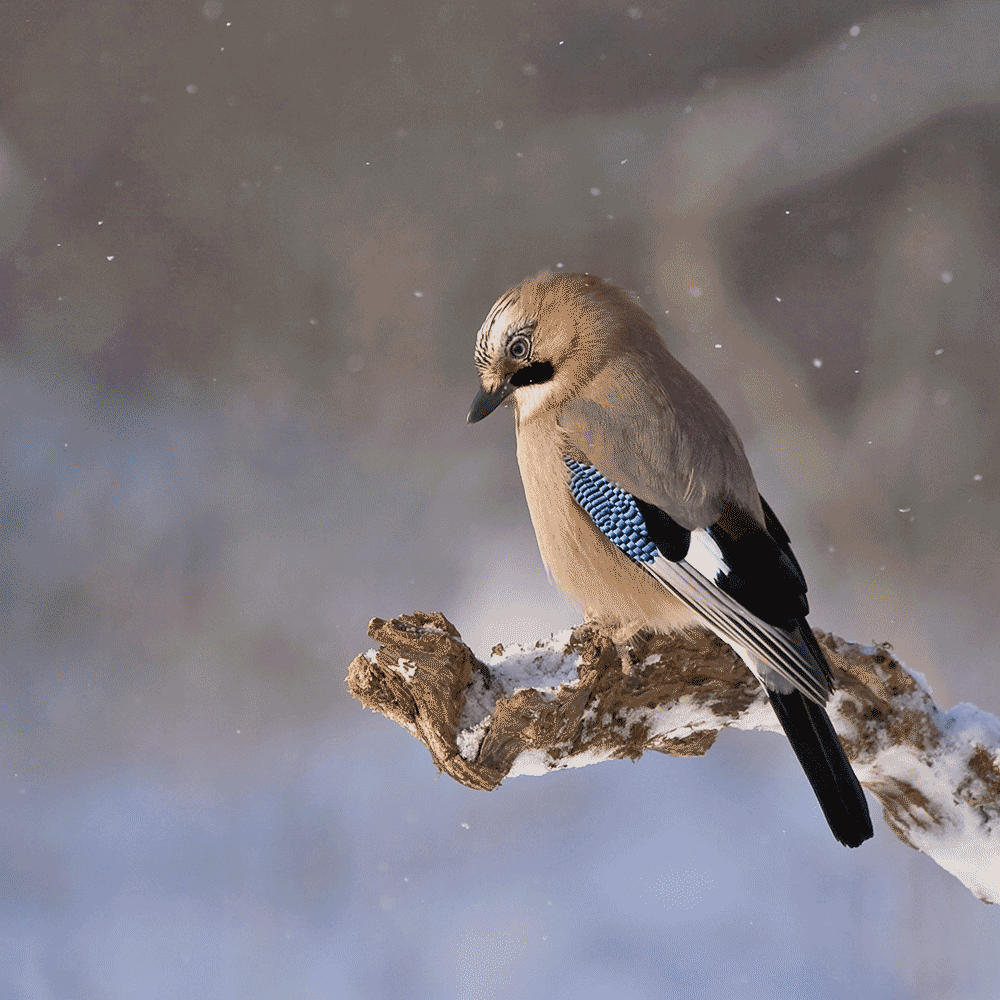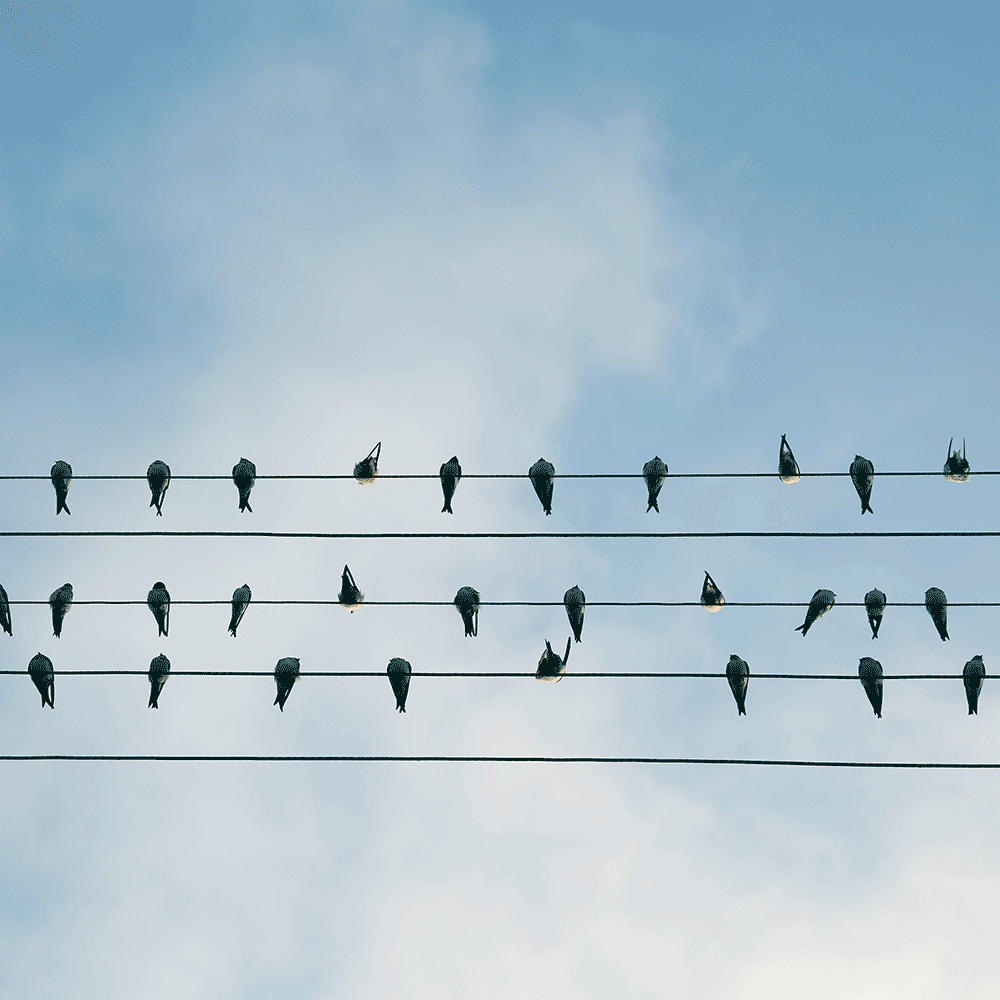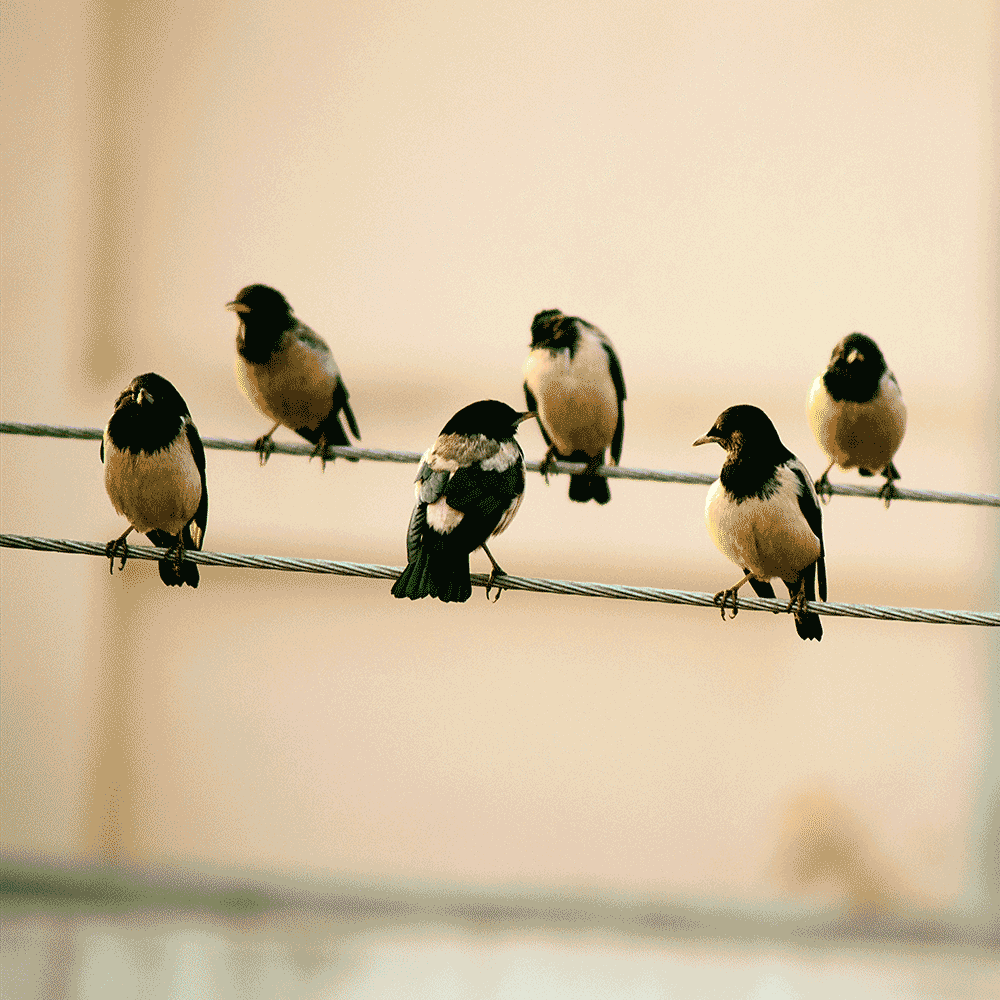Inhalt
- Aufhebungsvertrag: Das sollten Sie wissen
- Was genau ist ein Aufhebungsvertrag?
- Aufhebungsvertrag oder Kündigung: Das sind die Unterschiede
- Aufhebungsvertrag: Das sollten Sie beachten
- Wie kann ich einen Aufhebungsvertrag rückgängig machen?
- Gibt es nach einem Aufhebungsvertrag Arbeitslosengeld?
- Wer zahlt die Krankenversicherung beim Aufhebungsvertrag?
Aufhebungsvertrag: Das sollten Sie wissen
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch einen Aufhebungsvertrages kann durchaus für beide Seiten – für Sie und Ihren Arbeitgeber – eine gewinnbringende Alternative zur Kündigung sein.
Allerdings überwiegen in der Praxis die Nachteile für Arbeitnehmer deutlich – jedenfalls dann, wenn sie ohne anwaltliche Beratung abgeschlossen werden.
Oft werden Aufhebungsverträge vom Arbeitgeber in unangekündigten Personalgesprächen im Anschluss an eine längere Einleitung über Ihre angeblichen Verfehlungen und schwerwiegenden Arbeitsvertragsverstöße „angeboten“ und Sie werden durch Drohungen mit einer fristlosen Kündigung, einem schlechten Zeugnis oder gar Strafanzeigen dazu gedrängt, den Vertrag zu unterschreiben – an Ort und Stelle.
Dass ein solcher Aufhebungsvertrag nicht zu Ihrem, sondern allein zum Vorteil Ihres Arbeitgebers ist, ist nicht schwer zu erraten. Selbst wenn an den Vorwürfen gegen Sie etwas dran sein sollte, ist die Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung für Sie in aller Regel die schlechteste Variante, denn:
- Sie verlieren Ihren Kündigungsschutz
- die Kündigungsfrist wird mit dem Aufhebungsvertrag meist deutlich verkürzt Sie erhalten zunächst kein Arbeitslosengeld weil die Arbeitsagentur eine Sperrzeit verhängt
- Wenn der Vertrag das Arbeitsverhältnis mitten in einem Monat beendet, bekommen Sie erhebliche Probleme bei der Jobsuche, weil das „ungerade“ Beendigungsdatum in Ihrem Arbeitsvertrag abzulesen ist.
Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages kann von Ihrem Arbeitgeber nicht erzwungen werden. Ihre Aufgabe besteht in einer solchen Nötigungssituation darin, dem Druck standzuhalten und sich eine Bedenkzeit zu erbeten. Was auch immer Ihr Arbeitgeber Ihnen für den Fall androht, dass Sie den Vertrag nicht unterschreiben – er wird es nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden tun, wenn für ihn die Chance besteht, dass Sie den Aufhebungsvertrag unterschreiben. Sie haben also immer noch Zeit genug, sich anwaltlichen Rat einzuholen.

Tanja Ruperti, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Berlin
»Keine Unterschrift ohne Bedenkzeit und anwaltliche Beratung!«
Was genau ist ein Aufhebungsvertrag?
Ein Aufhebungsvertrag (auch Auflösungsvertrag oder Aufhebungsvereinbarung genannt) ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, durch den das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung aufgelöst wird. In dem Aufhebungsvertrag werden die Bedingungen geregelt, zu denen der Arbeitsvertrag beendet werden soll. Ein Aufhebungsvertrag ist also eine Alternative zur Kündigung, wenn beide Seiten das Arbeitsverhältnis „einvernehmlich“ beenden wollen.
Da es sich bei dem Aufhebungsvertrag um einen Vertrag handelt, müssen sich beide Seiten einig sein, dass sie das Arbeitsverhältnis beenden wollen. Eine Aufhebungsvereinbarung kommt nur zustande, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Vertrag unterschreiben. Sie können also nicht gezwungen werden, Ihr Arbeitsverhältnis durch eine Auflösungsvereinbarung zu beenden.
Anders ist das bei einer Kündigung. Eine Kündigung ist eine einseitige Erklärung des Arbeitgebers oder auch des Arbeitnehmers, durch die das Arbeitsverhältnis zum Kündigungstermin beendet wird, ob der Andere das will oder nicht.
Aufhebungsvertrag oder Kündigung:
Das sind die Unterschiede
Wenn das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag beendet wird, dann finden die gesetzlichen Kündigungsschutzregelungen keine Anwendung.
Das bedeutet, dass bei einem Auflösungsvertrag die sonst üblichen Kündigungsfristen nicht eingehalten werden müssen. Auch eine im Arbeitsvertrag geregelte Kündigungsfrist muss nicht eingehalten werden. Durch den Aufhebungsvertrag kann das Arbeitsverhältnis von heute auf morgen beendet werden.
Auch der weitere gesetzliche Kündigungsschutz fällt weg. Es spielt also keine Rolle, wie lange Sie schon im Unternehmen beschäftigt sind und wie gut Ihre Leistungen waren. Der Arbeitgeber muss auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob Sie eigentlich einen besonderen Kündigungsschutz hätten, weil Sie schwanger oder schwerbehindert oder Mitglied des Betriebsrats sind.
Auch hat der Betriebsrat bei einem Auflösungsvertrag kein Mitspracherecht. Er wird also nicht beteiligt und prüft dementsprechend auch nicht, ob soziale Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt werden.
Welche Vorteile hat ein Aufhebungsvertrag?
Während ein Aufhebungsvertrag eine ganze Reihe von Vorteilen für den Arbeitgeber hat, sind die Vorteile für Sie als Arbeitnehmer/in überschaubar.
Die einzigen relevanten Vorteile eines Aufhebungsvertrages für Sie sind die Zahlung einer Abfindung und die Ausstellung eines guten Zeugnisses.
- Kein gesetzlicher Anspruch auf Abfindung: Entgegen einer immer noch weit verbreiteten Meinung gibt es grundsätzlich keinen gesetzlichen Anspruch auf Abfindungszahlung. Sie sind deshalb darauf angewiesen, eine Abfindung mit Ihrem Arbeitgeber auszuhandeln. Hierfür kann der Aufhebungsvertrag eine gute Möglichkeit bieten. Denn warum sollten Sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, wenn Sie keinen finanziellen Vorteil dadurch haben?
- Kein Anspruch auf ein gutes Zeugnis: Auf das Arbeitszeugnis haben Sie zwar einen gesetzlichen Anspruch. Der richtet sich aber nur allgemein auf die Erteilung eines schriftlichen, qualifizierten (also ein auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis erstrecktes) Zeugnisses. Einen Anspruch auf eine bestimmte Zeugnisnote haben Sie nach dem Gesetz erst einmal nicht. Der Aufhebungsvertrag bietet Ihnen die Möglichkeit, hier gleich eine bestimmte Zeugnisnote und gegebenenfalls weitere inhaltliche Vorgaben festzulegen, um spätere Streitigkeiten wegen des Zeugnisses zu vermeiden.
Diese „Vorteile“ sollten Sie nicht überbewerten. Denn Abfindungen werden, wenn Sie Kündigungsschutz genießen, regelmäßig auch im Fall einer Kündigung im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses gezahlt und auch über ein Zeugnis lässt sich im Rahmen eines Vergleichs vor dem Arbeitsgericht in aller Regel eine Einigung erzielen.
Welche Nachteile hat ein Aufhebungsvertrag?
Aber auch dann, wenn die Ausgangslage nicht ganz so bedrohlich ist wie anfangs beschrieben oder die Initiative für eine Aufhebungsvereinbarung gar von Ihnen selbst ausgeht, ist Vorsicht geboten. Der Aufhebungsvertrag hat nicht nur arbeitsrechtliche, sondern auch ganz erhebliche sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen, die durch die vertraglichen Regelungen möglichst aufgefangen werden sollten.
Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages hat für Sie regelmäßig mehrere wirtschaftlich bedeutsame Nachteile:
- eine 3monatige Sperrzeit für den Bezug des Arbeitslosengeldes
- zusätzlich Kürzung Ihres Arbeitslosengeldanspruchs um ¼ der Gesamtanspruchsdauer
- eine (teilweise) Verrechnung Ihrer Abfindung mit dem Arbeitslosengeld
- Keinen Krankengeldanspruch während der Sperrzeit
Aufhebungsvertrag: Das sollten Sie beachten
Selbst wenn Sie bereits seit Jahren in einem größeren Unternehmen beschäftigt sind und deshalb für Ihren Arbeitgeber nur schwer zu kündigen wären, können Sie Ihr Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag ohne Weiteres beenden.
Schließen Sie einen Aufhebungsvertrag, muss weder eine Kündigungsfrist eingehalten, noch muss der Betriebsrat angehört werden, noch steht der besondere Kündigungsschutz (z.B. für Schwangere, Mitglieder des Betriebsrates oder schwerbehinderte Menschen) der Wirksamkeit der Aufhebungsvereinbarung im Wege.
Wenn Sie als Arbeitnehmer/in einen Aufhebungsvertrag abschließen, sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie Ihren Kündigungsschutz freiwillig aufgeben.
Wie kann ich einen Aufhebungsvertrag rückgängig machen?
Ist der Aufhebungsvertrag einmal geschlossen, können Sie ihn nur sehr schwer wieder rückgängig machen (anfechten). Auch nicht, wenn Sie später feststellen, dass Sie wichtige Regelungen vergessen haben oder damit Nachteile für Sie verbunden sind, die sie zuvor nicht bedacht haben.
Vor diesem Hintergrund sollten Sie sich den Abschluss eines Aufhebungsvertrages gut überlegen und Vor- und Nachteile – am besten mit Beratung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht gegeneinander abwägen.
In den folgenden Ausnahmefällen können Sie den Vertrag aber doch wirksam anfechten:
- wenn die Unterschrift durch eine widerrechtliche Drohung erzwungen wurde
- wenn Sie durch eine arglistige Täuschung zur Unterschrift verleitet wurden
- wenn der Auflösungsvertrag wegen eines Betriebsübergangs abgeschlossen wurde
Unterschrift wegen Drohung
Nicht jede Drohung führt dazu, dass Sie den Auflösungsvertrag erfolgreich anfechten können. Die Drohung muss auch widerrechtlich sein. Eine widerrechtliche Drohung liegt vor, wenn Ihr Arbeitgeber mit einer Kündigung droht, obwohl es offensichtlich keinen Kündigungsgrund gibt.
Ihr Arbeitgeber droht Ihnen auch dann widerrechtlich, wenn er Ihnen mit einer Strafanzeige oder mit der Forderung von Schadenersatz droht, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt.
Unterschrift wegen arglistiger Täuschung
Einen Anfechtungsgrund haben Sie auch dann, wenn Ihr Arbeitgeber bewusst die Unwahrheit gesagt hat, um Sie zur Unterschrift unter den Aufhebungsvertrag zu bewegen.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn er Sie täuscht, indem er behauptet, der Betrieb werde stillgelegt, obwohl das gar nicht geplant ist. Eine arglistige Täuschung liegt auch vor, wenn Ihr Arbeitgeber versichert hat, der Aufhebungsvertrag wirkt sich nicht nachteilig auf Ihren Kündigungsschutz aus. Das tut er nämlich sehr wohl.
Aufhebungsvertrag wegen Betriebsübergang
Die Kündigung wegen eines Betriebsübergangs ist rechtlich nicht zulässig (§ 613a Abs. 4 BGB). Versucht Ihr Arbeitgeber dieses Kündigungsverbot durch einen Aufhebungsvertrag zu umgehen, dann ist das ebenfalls ein Grund für eine Anfechtung.
Gibt es nach einem Aufhebungsvertrag Arbeitslosengeld?
Erste Voraussetzung dafür, dass Sie nach einem Aufhebungsvertrag Arbeitslosengeld in der vollen Höhe erhalten ist, dass Sie sich sofort nachdem Sie ihn abgeschlossen haben, frühestens jedoch drei Monate vor dem im Aufhebungsvertrag vereinbarten Ende des Arbeitsverhältnisses bei der Arbeitsagentur melden. Ist der im Aufhebungsvertrag vereinbarte Beendigungstermin Ihres Arbeitsvertrags also kürzer als 3 Monate, dann melden Sie sich sofort bei der Arbeitsagentur. Ist das vereinbarte Ende länger als 3 Monate, dann brauchen Sie sich nicht sofort bei der Arbeitsagentur melden, sondern erst 3 Monate vor Ablauf der Frist.
Trotz rechtzeitiger Meldung erhalte Sie aber in aller Regel eine Sperrzeit für den Bezug von Arbeitslosengeld, wenn Sie durch den Aufhebungsvertrag Ihr Arbeitsverhältnis „freiwillig“, also ohne berechtigten Grund beenden. Die Arbeitsagentur bestraft Arbeitnehmer regelmäßig mit einer 3monatigen Sperrfrist, wenn keine Notwendigkeit besteht, den Arbeitsvertrag aufzulösen.
Unfreiwillig ist der Abschluss eines Aufhebungsvertrags nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, wenn Sie durch den Aufhebungsvertrag lediglich einer Kündigung zuvor gekommen sind, weil Ihr Arbeitgeber anderenfalls eine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen hätte. Die Arbeitsagentur darf in diesem Fall keine Sperrzeit verhängen.
Eine Sperrzeit dürfen Sie auch dann nicht erhalten, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen für Sie notwendig war. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Sie wegen Mobbings bereits seit längerem erkrankt sind und ihr Arzt eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen dringend befürwortet. In einem solchen Fall sollten Sie sich aber unbedingt vor Abschluss des Aufhebungsvertrags mit der Arbeitsagentur abstimmen und sich das OK für den Aufhebungsvertrag möglichst schriftlich bestätigen lassen.
Wer zahlt die Krankenversicherung beim Aufhebungsvertrag?
Wenn Sie einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen haben durch den das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet wird und Sie von der Arbeitsagentur eine Sperrzeit bekommen, stellt sich die Frage, was bis zum Ablauf der Sperrzeit mit Ihrer Krankenversicherung passiert.
Bei einer Sperrzeit sind Sie zunächst einmal nicht über die Arbeitsagentur krankenversichert. Dies gilt aber nur für die ersten 4 Wochen der Sperrzeit. Ab der 5. Woche sind Sie bereits über die Arbeitsagentur krankenversichert ((§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V).
In der Zwischenzeit, also in den ersten 4 Wochen, sind Sie noch über Ihre Krankenversicherung im Rahmen der sogenannten „Nachversicherungspflicht“ krankenversichert (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V). Diese Nachversicherung ist beitragsfrei.
Das bedeutet für Sie, dass Sie sich über die Krankenversicherungsbeiträge bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags keine Sorgen machen müssen. Allerdings haben Sie während der Sperrfrist keinen Anspruch auf Krankengeld ((§ 49 Abs. 1 Nr. 3a SGB V).
Ich berate Sie gern zum Thema Aufhebungsvertrag. Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Termin bei mir.
Bitte füllen Sie einfach das Online-Formular aus: